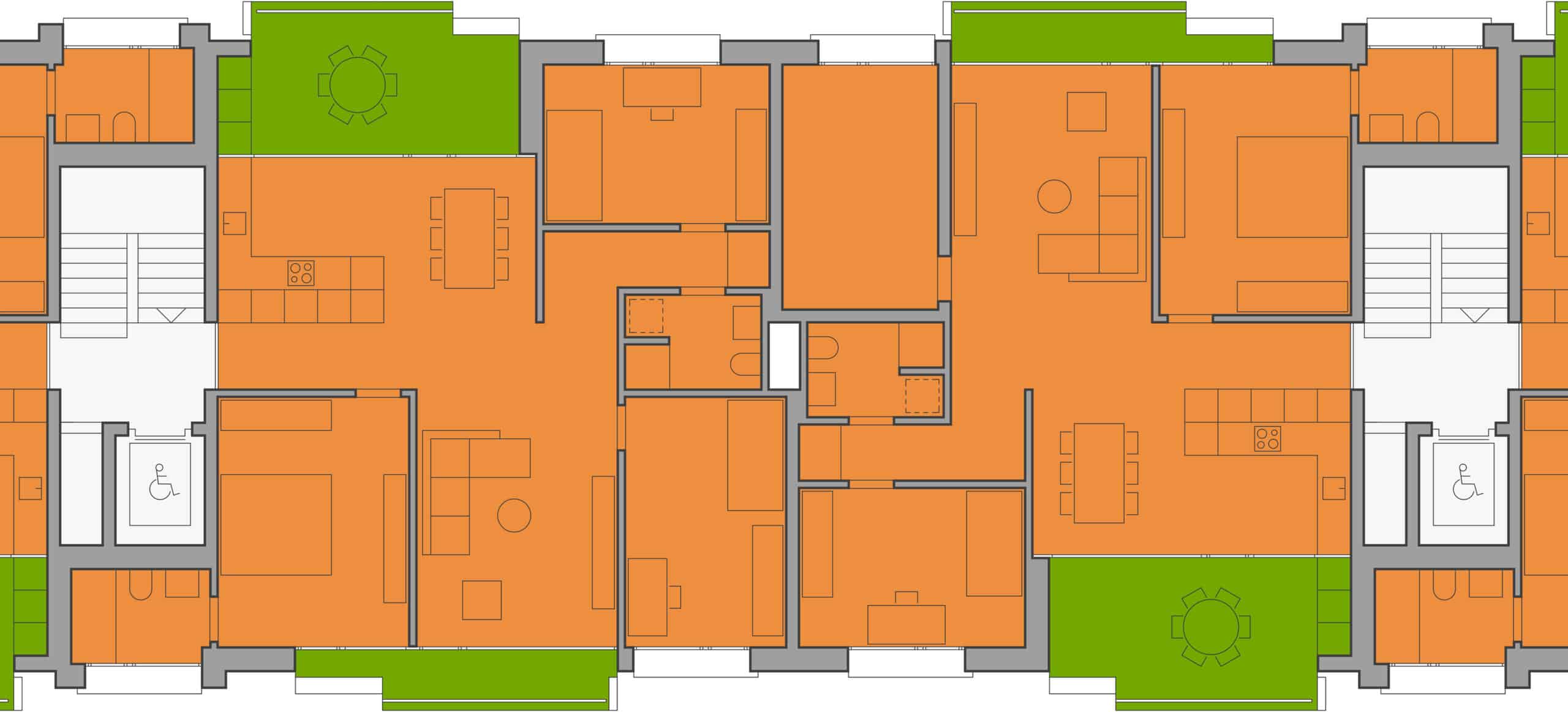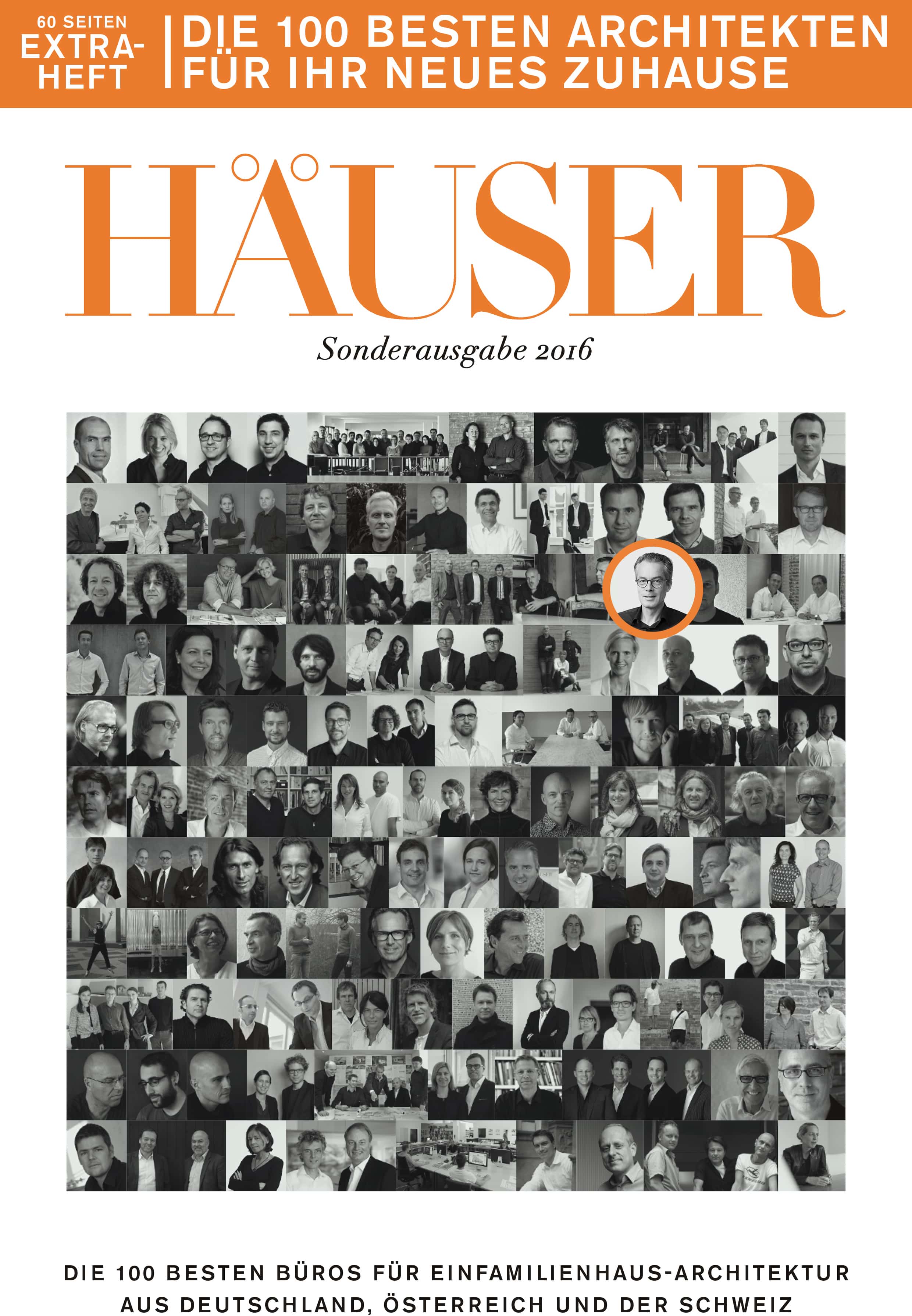Durch die BIM-Marketingoffensive – mit einer Flut von Inseraten in Fachzeit-Schriften, Sonderbeilagen (Content-Marketing) in Zeitungen oder Magazinen, durch Mediaplanet aufbereitet und bezahlt von den CAD-Distributoren, Hochschulen und anderen – ist das Wort BIM nun jedem Architekten ein Begriff. Jedoch für die meisten immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe mich letztes Jahr relativ intensiv mit der BIM-Methode auseinandergesetzt und bin zum Schluss gekommen, dass BIM momentan für die meisten Architekten noch keinen Sinn macht. Siehe auch Post vom 22. Oktober 2016, BIM: Ein Fazit – Teil III.
Dass so viel Werbung für etwas gemacht werden muss, was angeblich so viele Vorteile für Bauherren, Planer, Unternehmer und auch das Facility Management hat, ist schon bemerkenswert … Das grosse Interesse bei den CAD-Distributoren ist darauf zurückzuführen, dass durch die BIM-Methode das Geschäftsfeld für CAD-Programme vergrössert werden kann. Neu brauchen auch das Facility Management oder andere am Bau beteiligten Unternehmer ein CAD-Programm, um die Möglichkeiten von BIM voll zu nutzen. Zudem sind die Schulungen, welche für BIM notwendig sind, kein unattraktives Geschäft.
Die Erwartungen, die durch die Anwendung der BIM-Methode geweckt werden, sind teilweise schon erstaunlich:
«Der Bauherr soll den zu Beginn versprochenen, architektonischen Ausdruck oder die Raumstimmung zu seinen Preisvorstellung erhalten – ohne Kompromisse.»
Philipp Wieting Inhaber Werknetz Architektur – Arc-Award BIM-Preisträger 2016
Bei den Wörtern «Preisvorstellung» / «ohne Kompromisse» muss ich schon etwas schmunzeln. Der Preis wird nach wie vor am Markt gemacht, auch mit der BIM-Methode.
Der folgende Brief meines CAD-Distributoren (IDC Sarnen) wirkt dann doch etwas aufgeregt und überstürzt:
«ACHTUNG – DRINGENDE INFORMATION ZU BIM» Bei diesem Titel, alles gross geschrieben, bekommt man fast schon etwas Angst! Auch der Schluss des Informations-Briefes zur optimalen Vorbereitung auf BIM lässt aufhorchen: «Ein digitales Gebäudemodell ist heute bereits Realität und für jeden Bauspezialisten eine unumgängliche Pflicht!»
Dass die BIM-Metode für uns Architekten in Zukunft viele Vorteile hat, steht ausser Frage. Nur finde ich es etwas stossend, wenn nun alle BIM auf Befehl anwenden müssen, obwohl das Ganze noch in den Kinderschuhen steckt! Sachliche Information ist wichtig, auch Leuchturm-Projekete, welche heute in der Schweiz mit BIM geplant werden, sind für die Entwicklung der BIM Methode zusammen mit den Hochschulen von grosser Bedeutung. Der Einstieg und das Arbeiten mit BIM wird mit jedem CAD-Update einfacher, so wie das mit jeder Technologie ist. Mein Motto zum aktuellen ;BIM-Aktionismus: «Keep calm and carry on»
Tipps:
- TECH21 Nr. 21 / 2019 Beilage Sonderheft: BIM Reality Check
- SRF Digitalredaktion 21.02.2018 von Reto Widmer: Effizienz dank BIM – Die Digitalisierung erreicht das Baugewerbe
- IDC Brief vom 1. März 2017: «ACHTUNG – DRINGENDE INFORMATION ZU BIM» (IDC-Brief als PDF)